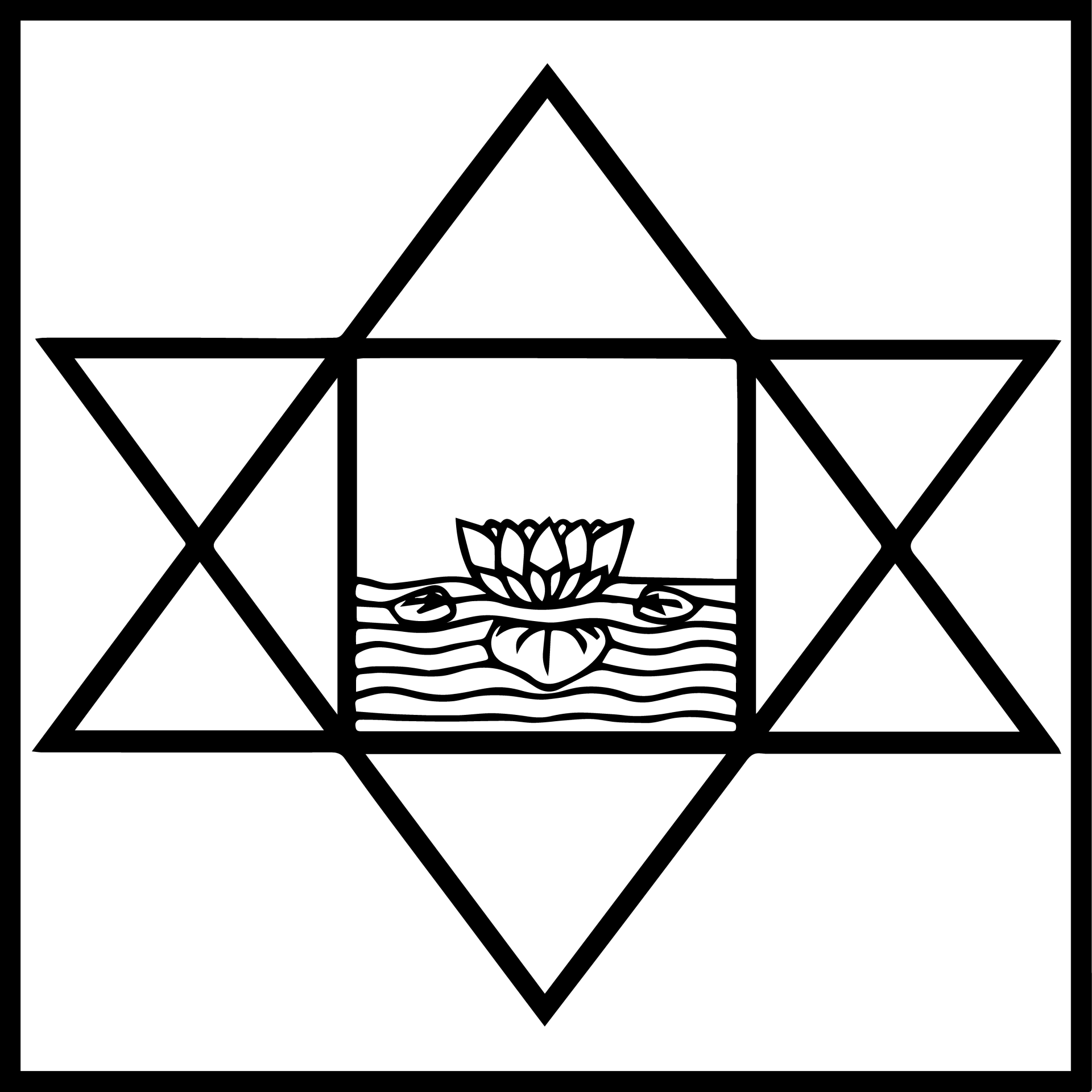Neuntes Buch
Das Buch von der ewigen Nacht
Erster Canto
Zur schwarzen Leere hin
So wurde sie in dem riesigen Wald allein gelassen,
Umgeben von einer düsteren gedankenlosen Welt,
An ihrer verlassenen Brust den Leichnam ihres Gemahls.
In ihrem weiten stillen Geist unbewegt,
Maß sie nicht mit ratlosen Gedanken ihren Verlust,
Brach nicht mit Tränen die Marmorsiegel des Schmerzes:
Noch erhob sie sich nicht, dem furchtbaren Gott entgegenzutreten.
Über den Körper, den sie liebte, beugte ihre Seele sich
In einer großen Stille ohne Regung oder Stimme,
Als wäre ihr mentaler Geist mit Satyavan gestorben.
Doch schlug das menschlich Herz noch weiter in ihr.
Gewahr noch seines Wesens, das ihrem nah,
Umfing sie fest die stumme leblose Gestalt,
Als wollte sie die Einheit behüten, die sie waren,
Und den Geist noch in seinem Gehäuse halten.
Da kam auf einmal die Wandlung über sie,
Die in ungeheuren Augenblicken unseres Lebens
Manchmal die menschliche Seele ergreifen kann
Und hoch sie heben zu ihrem leuchtenden Quell.
Der Schleier ist zerrissen, der Denker ist nicht mehr:
Nur der Geist schaut, und alles wird erkannt.
Eine ruhige Macht, die ihren Sitz über unseren Brauen hat,
Ist dann zu sehen, unerschüttert von unseren Gedanken und Taten,
Ihre Stille trägt die Stimmen der Welt:
Reglos, bewegt sie Natur, schaut auf das Leben.
Sie formt unwandelbar ihre fernen Ziele;
Unberührt und ruhig inmitten von Irrtum und Tränen
Und unermesslich über unserem strebenden Willen,
Überwacht ihr Blick den turbulenten Wirbel der Dinge.
Sich mit der erblickten Glorie zu vereinen, wächst der Geist:
Die Stimme des Lebens ist auf Unendlichkeitsklänge gestimmt,
Die Augenblicke kommen auf großen Schwingen des Blitzes
Und gottgleiche Gedanken überraschen das Mental der Erde.
In die Pracht und Stärke der Seele
Wird eine Mondsichel von wundersamer Geburt geworfen,
Deren Horn des Mysteriums in einer hellen Leere schwebt.
Wie in einem Himmel voll Kraft und Schweigen das Denken
Entzückt wird, so wird dieser lebendig sterbliche Lehm
Erfasst und in einer raschen und feurigen Flut
Von Berührungen geformt von einem ungesehenen Harmoniker.
Eine neue Sicht kommt, neue Stimmen in uns bilden
Einen Körper aus der Musik der Götter.
Unsterbliche Sehnsüchte ohne Namen springen hernieder,
Weite Beben der Gottheit strömen suchend
Und weben auf einem gewaltigen Feld der Ruhe
Eine hohe und einsame Ekstase des Willens.
Dies ward in den Tiefen eines Augenblicks in ihr geboren.
Offengelegt jetzt dem grenzenlosen Blick, der sieht,
Was menschlichen Denkens irdischen Lidern verschlossen ist,
Der Geist, der sich in der Natur versteckt hatte, stieg
Inmitten der Welten aus seinem leuchtenden Nest:
Wie ein gewaltiges Feuer erklomm es die Himmel der Nacht.
Derart wurden die Stricke der Selbstvergessenheit zerrissen:
Wie eine, die zu fernen Höhen aufschaut, sah sie,
Uralt und stark wie auf einem windstillen Gipfel
Über sich, wo sie in ihrem einsamen Mental gewaltet hatte,
Sich mühend in einem alleinigen Turm des Selbstes,
Die Quelle von allem, was sie schien oder wirkte,
Eine Macht, projiziert in den kosmischen Raum,
Eine allmähliche Verkörperung des äonischen Willens,
Ein Sternfragment von der ewigen Wahrheit,
Das passionierte Instrument einer unbewegten Macht.
Eine Gegenwart erfüllte die lauschende Welt;
Ein zentrales All übernahm ihr grenzenloses Leben.
Als eine Souveränität, ein Schweigen und eine Schnelligkeit
Grübelte jemand über den Abgründen, und das war sie.
Wie in einem chorischen Gewand von ungehörten Klängen
Stieg eine Kraft herab, nach sich ziehend endlose Lichter;
Der Zeit Sekunden mit Unendlichem verknüpfend,
Umfasste diese die Erde und sie unermesslich weit,
Sank ein in ihre Seele und verwandelt war sie.
Dann, wie ein Gedanke vollendet durch ein großes Wort,
Nahm dies Mächtige eine Symbolgestalt an:
Die Räume ihres Wesens bebten unter seiner Berührung,
Es bedeckte sie wie mit unsterblichen Flügeln;
Auf seinen Lippen den Bogen der ungeäußerten Wahrheit,
Ein Strahlenkranz aus der Weisheit Blitzen als seine Krone,
So betrat es den mystischen Lotus ihres Hauptes,
Ein tausendblättriges Heim von Macht und Licht.
Unsterblicher Führer ihrer Sterblichkeit,
Vollbringer ihrer Werke und Quelle ihrer Worte,
Unangreifbar durch Zeit, allmächtig,
Stand über ihr es ruhig, reglos, stumm.
Alles in ihr verband sich mit jener mächtigen Stunde,
Als wäre vom Tod erschlagen der letzte Rest
Des Menschentums, das einstmals ihr eigen war.
Eine spirituelle weitreichende Kontrolle übernehmend,
Des Lebens Meer zum Spiegel des Himmels Firmament machend,
Die junge Gottheit in ihren irdischen Gliedern
Füllte mit himmlischer Stärke ihren sterblichen Teil.
Vorbei war der aufdringliche Schmerz, die zerreißende Angst:
Ihr Kummer war dahingegangen, ihr mentaler Geist war still,
Ihr Herz schlug ruhig mit einer souveränen Kraft.
Eine Freiheit kam von der Herzstricke Griff
Und all ihr Tun entsprang jetzt aus der Ruhe einer Gottheit.
Ruhig legte sie auf den Boden des Waldes
Den Toten, der noch weilte an ihrer Brust,
Und ertrug es von der toten Gestalt sich abzuwenden:
Allein nun erhob sie sich, dem furchtbaren Gott gegenüberzutreten.
Dieser mächtigere Geist richtete seinen herrischen Blick
Auf Leben und Dinge, Erbe eines Werkes
Das ihm unvollendet blieb aus ihrer stockenden Vergangenheit,
Wo der mentale Geist, ein leidenschaftlich Lernender, sich mühte
Und ungeformte Instrumente grob gehandhabt wurden.
Überschritten war nun die armselig menschliche Norm;
Da war eine souveräne Macht, ein gottgleicher Wille.
Einen Augenblick noch verweilte sie regungslos
Und sah auf den Toten zu ihren Füßen herab;
Dann, wie ein Baum vom Winde sich erholt,
Hob sie ihr edles Haupt; vor ihrem Blick
Da stand etwas, unirdisch, düster, groß,
Eine grenzenlose Verneinung allen Seins,
Die trug das Schrecknis und Wunder einer Gestalt.
In entsetzlichen Augen trug die düstere Form
Das tiefe Mitleid von zerstörenden Göttern;
Eine gramvolle Ironie umspielte die schauerlichen Lippen,
Die das Wort des Unheils sprechen. Ewige Nacht
Stieg in der schauderhaften Schönheit eines unsterblichen Gesichts
Bemitleidend auf, empfangend alles Lebendige
Für immer in seinem unergründlichen Herzen, Zuflucht
Der Geschöpfe aus ihrer Angst und Weltpein.
Seine Gestalt war real gewordenes Nichts, seine Glieder
Waren Monumente der Vergänglichkeit und unter
Brauen beharrlicher Ruhe schauten große gottgleiche Lider
Still die sich windende Schlange, das Leben.
Ungerührt hatte deren zeitlos weiter unveränderlicher Blick
Die unergiebigen Zyklen vorbeigehen sehen
Und den Untergang von zahllosen Sternen überlebt
Und barg noch immer dieselben unwandelbaren Himmelskörper.
Die beiden standen sich Auge in Auge gegenüber,
Frau und universeller Gott: Um sie herum nahten,
Türmend ihre leere unerträgliche Einsamkeit
Auf ihre mächtige unbegleitete Seele,
Viele unmenschliche Einöden.
Leere Ewigkeiten, verbietend Hoffnung,
Legten ihren großen und leblosen Blick auf sie,
Und an ihre Ohren, erstickend irdische Laute,
Drang eine traurige und schreckliche Stimme,
Als sei sie die der ganzen Feindwelt. „Gib auf“, schrie die,
„Deinen leidenschaftlichen Einfluss und löse dich, O Sklavin
Der Natur, wandelbares Werkzeug des unwandelbaren Gesetzes,
Die du vergeblich dich auflehnst gegen mein Joch,
Begreife dein elementares Wesen; weine und vergiss.
Begrabe deine Leidenschaft in ihrem lebendigen Grab.
Verlasse nun des einst geliebten Geistes abgelegtes Kleid:
Kehr allein zurück zu deinem nichtigen Leben auf Erden.“
Es wurde still, sie rührte sich nicht, und wieder ertönte die Stimme,
Dämpfend ihren gewaltigen Ton auf menschliche Akkorde, –
Doch ein schrecklicher Schrei hinter den geäußerten Lauten,
Widerhallend alle Traurigkeit und unsterblichen Hohn,
Ächzte wie ein Hunger fern rollender Wogen.
„Willst du dein leidenschaftliches Behalten für immer wahren,
Du selbst ein Geschöpf, das wie er vergehen muss,
Willst seiner Seele des Todes Ruhe und Stille verwehren?
Löse deinen Griff; dieser Körper ist der Erde und dein,
Sein Geist gehört jetzt einer größeren Macht.
Frau, dein Gatte leidet.“ Savitri
Zog die Kraft ihres Herzens zurück, die seinen Körper noch umfing,
Wo, aus ihrem Schoß entlassen, auf dem weichen Gras
Sanft er lag, wie früher so oft im Schlaf
Wenn sie von ihrem Lager aufstand in weißer Dämmerung,
Gerufen von ihren täglichen Pflichten: Auch jetzt, wie aufgerufen,
Erhob sie sich und stand gesammelt da in eigener Stärke,
Gleich einer, die für ein Rennen den Mantel abwirft
Und des Zeichens harrt, regungslos bereit.
Zu welchem Lauf wusste sie nicht: Ihr Geist oben
Auf dem Kryptagipfel ihrer geheimen Ausformung
Wie ein Posten, allein zurückgelassen im Gebirge,
Eine feuerfüßige Pracht, machtbeflügelt,
Hielt flammenschweigsam Wache, ihre stimmlose Seele
Wie ein unbewegtes Segel auf einem windstillen Meer.
Weiß, leidenschaftslos lag sie da als eine verankerte Urgewalt,
Wartend, welch fernaufgewallter Impuls sich erheben wird
Aus den ewigen Tiefen und seine Wogen wirft.
Dann beugte Tod, der König, sich grenzenlos nieder,
Wie Nacht sich neigt über müdes Land, wenn der Abend verblasst
Und schwindende Schimmer des Horizontes Wandungen brechen
Und noch kein Mond die Dämmerung mystisch macht.
Die düstere und furchtbare Gottheit erhob sich in die Höhe
Von seinem kurzen Bücken zu seiner Erdberührung,
Und, wie ein Traum der aus einem Traum erwacht,
Verlassend die ärmliche Form aus totem Lehm,
Ein anderer, leuchtender Satyavan stand auf,
Sich hebend von hingestreckter Erde empor
Wie jemand über unsichtbare Grenzen schritt
Und zum Saum von ungesehenen Welten gelangt.
In der Erde Tag stand das stille Wunder
Zwischen dem Gott und der sterblichen Frau.
Solcherart schien er, als käme ein Hingegangener
Erstrahlend im Lichte einer himmlischen Gestalt,
Herrlich fremd für die sterbliche Luft.
Der mentale Geist suchte Langgeliebtes und wich enttäuscht
Von Unvertrautem, geschaut und doch ersehnt,
Wenig befriedigt von der süßen strahlenden Gestalt,
Den allzu hellen Andeutungen des Himmels nicht ganz glaubend;
Zu fremd das leuchtende Gespinst für des Lebens Ergreifen,
Wünschend sich die warmen Schöpfungen der Erde,
Aufgezogen in der Glut der materiellen Sonnen,
Griffen die Sinne vergebens nach einem glanzvollen Schatten:
Allein der Geist erkannte noch den Geist,
Das Herz erahnte das einst geliebte Herz, wenn auch verändert.
Zwischen zwei Reichen stand er, nicht schwankend,
Sondern in ruhiger starker Erwartung fest,
Wie ein Blinder, der auf eine Weisung horcht.
So standen sie still auf jenem irdischen Feld,
Mächte nicht der Erde, wenn auch eine in menschlichem Lehm.
Zwei Geistwesen, beidseits von einem, stritten sich;
Schweigen kämpfte mit Schweigen, Weite mit Weite.
Doch nun war der Impuls des Pfades zu spüren,
Der da kommt aus jenem Schweigen her, das die Sterne trägt,
Um die Grenzgebiete der sichtbaren Welt zu berühren.
Lichtvoll bewegte er sich fort; hinter ihm ging der Tod
Langsam mit seinem lautlosen Schritt, wie geschaut
In traumerbauten Gefilden, wo schattenhaft ein Hirte
Einem Abgeirrten aus seiner stimmlosen Herde nachgleitet,
Und hinter ewigem Tod schritt Savitri,
Ihr sterblicher Gang hielt Schritt mit jenem des Gottes.
Wortlos folgte sie den Spuren Ihres Geliebten,
Setzend ihren Menschenfuß dorthin, wo seiner ging,
In die gefährlichen Schweigsamkeiten jenseits.
Erst bewegte sie sich durch unüberschaubares Gewirr von Gehölz
Mit seltsam nicht menschlichen Schritten über den Boden,
Reisend wie auf einer ungesehenen Straße.
Um sie herum auf der grünen und bildhaften Erde
Umgab der flimmernde Schirm der Wälder ihren Schritt;
Sein dichtes üppiges Hindernis der Zweige
Bedrängte ihren Körper, der schemenhaft sich durchschob
In ein üppiges Reich von eindringlichem Geflüster,
Und all die raunende Schönheit der Blätter
Umwogte sie wie ein smaragdgrünes Gewand.
Doch mehr und mehr wurde dies ein fremder Klang,
Und ihr altvertrauter Körper schien ihr nun
Eine Bürde, die ihr Wesen von weitem trug.
Sie selbst lebte fern an einem erhobenen Ort,
Wo für die trancegeforderte Schau der Verfolgung,
Einsame Gegenwärtigkeiten in einem hohen raumlosen Traum,
Der leuchtende Geist ruhig weiter glitt
Und der große Schatten unbestimmt dahinter wandelte.
Immer noch, mit einem verliebten Drängen suchender Hände
Sanft umschmeichelt von altem Verlangen,
Fühlten ihre Sinne die nahe und milde Luft der Erde
Sich um sie schmiegen und wussten in unruhigem Gezweig
Die ungewissen Tritte eines kleinfüßigen Windes:
Leise Düfte, ferne Rufe berührten sie;
Des wilden Vogels Stimme und sein Flügelrauschen kamen
Wie ein Seufzer aus einer vergessenen Welt.
Die Erde lag abseits und war doch nah: Sie wob
Ihre Lieblichkeit und ihr Grün und ihre Wonne um sie herum,
Geliebter lebhafter Farben holde Pracht,
Sonnenlicht, das zu ihrem goldnen Mittag steigt,
Und die blauen Himmel und die liebkosende Scholle.
Die uralte Mutter bot ihrem Kinde
Ihre einfache Welt aus freundlichen vertrauten Dingen dar.
Doch jetzt, als hätte der sinnliche Halt des Körpers,
Der in ihr der Gottheit unendlichen Gang im Zaume hielt,
Jene Geister entlassen für deren größeren Weg
Über die ungreifbare Schranke einer Grenze hin,
Ward der schweigende Gott machtvoll und unnahbar
In anderen Räumen, und das Seelenwesen, das sie liebte,
Verlor zu ihrem Leben seine zustimmende Nähe.
In eine dunkle und ungewohnte Luft
Ohne Regung oder Laut, ungeheuerlich, windlos,
Schienen sie sich weg zu dehnen, angezogen von einer weiten
Blassen Ferne, der warmen Kontrolle der Erde
Und ihr entrückt: Jetzt, jetzt würden sie entfliehen.
Da, flammend aus dem Nest ihres Körpers, alarmiert,
Schwang sich ihr ungestümer Geist zu Satyavan empor.
Aus dem Sturz der himmelsumgebenen Felsen
Stößt so herab voll Schreck und göttlichem Zorn
Aus ihrem hohen Horste gegen den emporsteigenden Tod,
Erzürnt über seine kauernde Spitze aus Stahl,
Die ihre Brut bedroht, eine wilde Adlerin
Von stürmischer Macht getragen und einem Schrei,
Ausschwingend wie eine Formation goldnen Feuers.
So getragen auf eines Geistes flammenden Heraussturz,
Durchquerte sie die Grenzbereiche trennenden Sinns;
Wie verblasste ausgediente Ummantelungen schlaff niederfallen,
So fielen ihre sterblichen Glieder von ihrer Seele ab.
Ein Augenblick des Schlafes eines geheimen Körpers,
Ihre Trance kannte weder Sonne noch Erde noch Welt;
Denken, Zeit und Tod waren ihrem Griff entschwunden:
Sie kannte nicht sich selbst, vergessen war Savitri.
Alles war der gewaltige Ozean eines Willens,
Wo gefangen lebte in einer ungeheuren Liebkosung,
Im Besitz einer höchsten Wesenseinheit,
Ihr Ziel, ihre Freude, ihr Ursprung, Satyavan allein.
Ihr Herrscher, gefangen im Kern ihres Wesens,
Er pochte dort wie ein rhythmisches Herz, – sie selbst
Und doch anders, ein Geliebtes, Umhülltes, Umklammertes,
Ein Schatz, gerettet vor dem Einsturz des Raumes.
Um ihn namenlos umwogte sie ihn unendlich,
Ihr Geist erfüllt in seinem Geist, reich an aller Zeit,
Als wäre der todlose Augenblick der Liebe gefunden,
Eine Perle in der weißen Muschel der Ewigkeit.
Dann stieg aus dem verschlingenden Meer der Trance
Ihr mentaler Geist durchtränkt zum Lichte, triefend von Farben
Der Vision und kehrte, von neuem der Zeit gewahr,
Zurück, um die Eigenart der Dinge zu umreißen
Und in Grenzen des Gesehenen und Bekannten zu leben.
So schritten die drei weiter auf ihrer Seelenbühne.
Wie schreitend durch Fragmente eines Traumes
Schien sie dahinzureisen, eine visionär gesehene Gestalt,
Die sich andere Träumer vorstellte gleich ihrer selbst,
Von ihnen vorgestellt in einsamem Schlaf.
Unerfasst, unwirklich, doch altvertraut,
Wie Klüfte wesenloser Erinnerung,
Flohen Szenen, oft durchstreift, doch nie bewohnt,
Zu vergessenen Zielen achtlos an ihr vorüber.
In stimmlosen Regionen waren sie Wanderer,
Allein in einer neuen Welt, in der es keine Seelen gab,
Sondern nur lebende Stimmungen: ein seltsam lautlos bizarres
Land umgab sie, seltsam ferne Himmel darüber,
Ein zweifelnder Raum, in dem träumende Dinge lebten,
In sich ihre eine immer gleiche Idee.
Bizarr waren die Gräser, bizarr die baumlosen Ebenen;
Bizarr verlief die Straße wie Angst eilend,
Dorthin wovor ihr am meisten graut,
Gespenstisch zwischen bewussten Säulenfelsen dahin,
Düster und hoch, brütende Tore, deren Steingedanken
Ihren großen Sinn verloren in gigantischer Nacht dort oben.
Rätsel der Nichtbewusstheit bildhauerischen Schlaf,
Symbole des Zugangs zu alter Finsternis
Und Monumente ihrer titanischen Herrschaft,
Offen auf Tiefen wie stumme entsetzliche Rachen,
Die einen Wanderer unten am gespenstischen Pfade erwarten,
Wohin ein mörderisches Mysterium ihn zieht,
So starrten sie auf ihren Pfad, grausam und still;
Wächter einer schweigsamen Notwendigkeit waren sie,
Stumme Häupter von wachsamer und mürrischer Schwermut,
Gemeißeltes Maul einer düsteren gewaltigen Welt.
Dann, an jener drückend schaurig öden Grenzlinie angelangt,
Wo sein Fuß der schattigen Marken Rand berührte,
Sah aufgehalten der leuchtende Satyavan
Mit seinen wundervollen Augen zurück zu Savitri.
Doch Tod ließ seinen gewaltigen abgrundtiefen Schrei erdröhnen:
„O Sterbliche, kehre zu deiner vergänglichen Art zurück;
Suche nicht dem Tod zu folgen bis zu seinem Heim,
Als könnte dein Atem leben, wo Zeit sterben muss.
Halte nicht deine mentalgebürtige Leidenschaft für Himmelsstärke,
Um deinen Geist von seinem Erdengrund zu erheben
Und, aus dem stofflichen Käfig brechend,
Deine Traumesfüße im bodenlosen Nichts zu halten,
Dich zu tragen durch das pfadlos Unendliche.
Nur in menschlichen Schranken lebt der Mensch sicher.
Vertraue nicht auf die unwirklichen Herren der Zeit,
Wähnend unsterblich dieses Bild deiner Selbst,
Das sie erbauten auf eines Traumes erdfreien Boden.
Lass nicht die fürchterliche Göttin deine Seele treiben
Zu unbefugt stürmischem Eindringen in Welten,
Wo sie wie ein machtloser Gedanke vergehen wird.
Erkenne die kalten Grenzsteine deiner Hoffnungen im Leben.
Vergeblich gewappnet mit des Ideals geborgter Macht, wage nicht
Des Menschen gebunden und bemessene Kraft zu überspannen:
Unwissend und stolpernd, in enge Schranken gepfercht,
Krönt er sich selbst zum Scheinoberhaupt der Welt,
Peinigend Natur mit den Werken des Mentals.
O Schläferin, die du träumst von Göttlichkeit,
Wache zitternd in den gleichgültigen Schweigsamkeiten auf,
In denen da verhallen deine paar schwachen Saiten des Seins.
Vergängliche Kreaturen, sorgenvoller Schaum der Zeit,
Eure flüchtige Liebe verpflichtet nicht die ewigen Götter.“
Die fürchterliche Stimme verebbte in der zustimmenden Stille,
Die sich über ihr zu schließen schien, umfassend, eindringlich,
Eine wortlose Gutheißung aus dem Schlund der Nacht.
Die Frau gab keine Antwort. Ihre hohe nackte Seele,
Entledigt des Gürtels der Sterblichkeit,
Stand auf gegen festes Schicksal und die Furchen des Gesetzes
In ihres reinen Willens Urgewalt.
Reglos wie eine Statue auf ihrem Sockel,
Einsam in der Stille und den Weiten entblößt,
Stieg gegen die stummen Schlünde der Mitternacht vor ihr
Sie als säulenartiger Schaft aus Feuer und Licht empor.
Ende des ersten Cantos