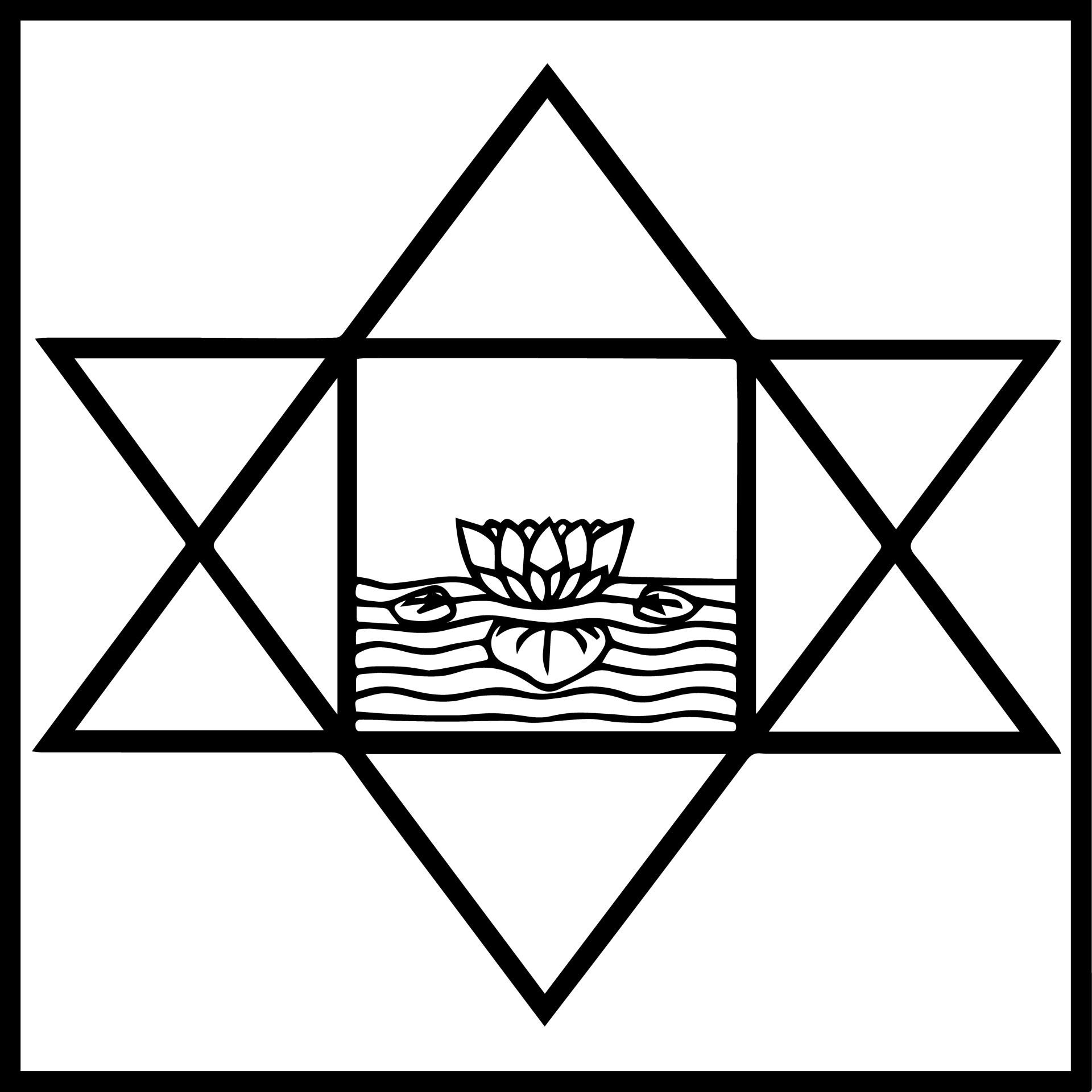Neuntes Buch
Das Buch von der ewigen Nacht
Zweiter Canto
Die Reise in ewiger Nacht und die Stimme der Finsternis
Eine Weile standen sie am kalten grausigen Rand der Nacht,
Als wäre eine Welt dem Untergang geweiht,
Und warteten an des ewigen Schweigens Saum.
Der Himmel neigte sich ihnen zu wie eine wolkige Stirn
Der Drohung durch die düstere und stimmlose Stille.
Wie Gedanken stumm vor verzweiflungsvollem Abgrund stehen,
Wo die letzten Tiefen in das Nichtsein stürzen
Und die letzten Träume enden müssen, verhielten sie; vor ihnen
Waren Düsternisse wie schattenhafte Flügel, hinter ihnen
Bleich der leblose Abend wie der Blick eines toten Menschen.
Von jenseits lechzte hungrig nach ihrer Seele die Nacht.
Doch noch brannte in ihrer einsamen Nische tempelhafter Kraft
Reglos, stumm und aufrecht ihr flammenheller Geist
Wie ein Fackelfeuer aus einem Raum mit Fenstern,
Gerichtet gegen die düstere Brust der Finsternis.
Die Frau bot zuerst dem Abgrund die Stirn,
Wagend die Reise durch die ewige Nacht.
Mit Licht gewappnet setzte vor sie ihren Fuß,
Um in die furchtbare und farblose Leere einzutauchen;
Unsterblich, unerschrocken, stellte sich ihr Geist
Der Gefahr unbarmherzig augenloser Ödnis.
Gegen den pechschwarzen Boden der Nacht rückten sie vor,
Ihrem menschlichen Schreiten eine mysteriöse Form gebend,
Eine schwimmende Bewegung und ein fließender Marsch,
Gleich Gestalten, die vor geschlossenen Augenlidern gehen:
Sie trieben, wie in Träumen gleitend, voran.
Die schweren Wälle des Felsentores blieben zurück;
Als ob durch Gänge weichender Zeit
Gegenwart und Vergangenheit ins Zeitlose entschwinden;
Am Rande düsteren Abenteuers aufgehalten,
Endete die Zukunft ertränkt im Nichts.
Durch zerfallende Formen wanden sie sich obskur;
Die hinschwindenden Vorhallen einer finsteren Welt
Empfingen sie, wo zu gehen sie schienen und dennoch
Stillzustehen, nicht vorwärts zu kommen und doch zu gehen,
Eine stumme Prozession, gebannt in dämmriges Bild,
Keine bewussten Gestalten, sich windend durch einen wirklichen Ort.
Ein Mysterium des Schreckens Grenzenlosigkeit,
Sammelnd seine hungrige Stärke, das gewaltig mitleidlose Leer
Kesselte langsam mit seinen lautlosen Tiefen ein,
Und ein unförmiger Rachen, monströs, höhlenartig,
Verschlang sie in seiner schattenhaft würgenden Masse,
Der heftige spirituelle Todeskampf eines Traumes.
Ein Vorhang von undurchdringlichem Grauen,
Die Dunkelheit umhing ihren Käfig der Sinne
Wie, wenn die Bäume zu fahlen Schemen werden
Und der letzte freundliche Schimmer verblasst,
Ein im Wald von Jägern angebundenes Rind
Von gar nicht leerer Nacht umschlossen wird.
Das Denken, das sich müht in der Welt, war ungeschaffen hier;
Es gab sein Bestreben auf, zu leben und zu wissen,
Zuletzt überzeugt, dass nie es gewesen sei;
Es ging zugrunde, sein ganzer Traum vom Handeln war vorbei:
Diese geronnene Ziffer war sein dunkles Resultat.
In dem erstickenden Druck dieses gewaltigen Nichts
Konnte Verstand nicht denken, Atem nicht atmen, die Seele
Sich nicht erinnern oder selber spüren; sie schien
Ein hohler Abgrund von steriler Leere zu sein,
Eine Null, die vergessen hat die Summe, die sie beschloss,
Eine Verleugnung des Schöpfers Freude,
Gerettet nicht durch weite Ruhe, nicht durch tiefen Frieden.
Auf alles, was hier behauptet, Wahrheit und Gott zu sein
Und bewusstes Selbst und das enthüllende Wort
Und die Schaffensfreude des Mentals
Und Liebe und Wissen und Herzens Wonne, da senkte sich
Die ungeheure Verweigerung des ewigen Nein nieder.
Wie eine goldne Lampe in der Finsternis verschwindet,
In die Ferne getragen aus des Auges Verlangen,
So schwand Savitri dahin in die Schatten.
Da gab es keine Richtung, keinen Pfad, kein Ende oder Ziel:
Sichtlos bewegte sie sich inmitten fühlloser Klüfte
Oder trieb durch irgend große schwarze unwissende Einöde
Oder wirbelte in einem stummen Wirbel aufeinander treffender Winde,
Zusammengeführt durch die Titanhände des Zufalls.
Niemand war bei ihr in der grauenvollen Weite:
Sie sah nicht mehr den vagen schrecklichen Gott,
Verloren war den Augen deren leuchtender Satyavan.
Trotzdem versagte nicht ihr Geist, sondern hielt
Viel inniger als die gebundenen Sinne es vermögen,
Die Äußeres ergreifen und finden, um zu verlieren,
Sein Geliebtes fest. So hatte sie, als sie noch auf Erden lebten,
Ihn durch Lichtungen streifen gefühlt, die Lichtungen
Ein Schauplatz in ihr mit Ausblicken ihres Wesens,
Die seiner Suche und Freude sich öffneten,
Weil zur eifersüchtigen Süße in ihrem Herzen,
Welch glücklichen Raum auch immer seine geliebten Füße
Bevorzugten, zugleich ihre Seele seinen Körper umarmen musste,
Die stumm zu seinem Schritte leidenschaftlich war.
Doch jetzt trat zwischen beide eine stille Kluft
Und sie fiel in abgrundtiefe Einsamkeit,
Sogar aus sich selbst geworfen, von Liebe weit entfernt.
Lange Stunden, denn lang scheint es, wenn kriechende Zeit
Gemessen wird vom Pochen der Seele Schmerz,
Schritt in einer unwirklichen Finsternis, leer und trostlos,
Über des Lebens Leichnam sie voran,
Verloren in einer Blindheit erloschener Seelen.
Einsam in der Angst der Leere
Lebte sie trotz Tod, sie eroberte noch;
Vergebens ward ihr mächtig Wesen unterdrückt:
Ihre schwere lange Eintönigkeit der Pein
Ermüdete allmählich von der heftigen Selbstquälerei.
Anfangs ein schwacher unauslöschlicher Schimmer,
Blass doch unsterblich, flackernd in der Düsternis
Als käme zu Gestorbenen eine Erinnerung zurück,
Eine Erinnerung, die wieder zu leben wünschte,
Losgelöst vom Mental im Geburtsschlaf der Natur.
Er schweifte verirrt wie ein verlorener Mondstrahl dahin
Und enthüllte der Nacht ihre Seele des Grauens;
Schlangenhaft rekelte das Dunkel in dem Schimmer sich,
Seine schwarzen Hauben juwelenbesetzt mit der mystischen Glut;
Seine träg glatten Falten schauderten, schlängelten, glitten zurück,
Als fühlten sie alles Licht als grausamen Schmerz
Und litten unter dem blassen Nahen der Hoffnung.
Nacht fühlte angegriffen ihre schwere düstere Herrschaft;
Der Glanz von irgend lichter Ewigkeit
Bedrohte mit diesem schwachen Schein von wandernder Wahrheit
Ihr Reich der immerwährenden Null.
In ihrer unduldsamen Stärke unerbittlich
Und überzeugt, dass wahr sei nur sie allein,
Wollte sie ersticken den zarten gefährlichen Strahl;
Einem alles verneinend Unermesslichen gewahr,
Bäumte sie ihr riesiges Haupt des Nichts auf
Und ihr Maul des Dunkels verschluckte alles, was ist;
Sie sah in sich das düstere Absolute.
Doch noch immer obsiegte das Licht und wuchs,
Und Savitri erwachte zu ihrem verlorenen Selbst;
Ihre Glieder entzogen sich der kalten Umarmung des Todes,
Ihr Herzschlag triumphierte im Griff des Schmerzes;
Ihre Seele beharrte, fordernd für sich zur Freude
Die Seele des Geliebten, der jetzt nicht mehr zu sehen war.
Vor sich in der Stille der Welt
Hörte sie nun wieder das Schreiten eines Gottes,
Und aus der stummen Dunkelheit erwuchs Satyavan,
Ihr Gemahl, zu einem leuchtenden Schatten.
Dann dröhnte ein Laut durch dies tote grässliche Reich:
Gewaltig wie die Brandung in eines erschöpften Schwimmers Ohren,
Tobend, ein verhängnisvoll eisenherziges Gebrüll,
Entsandte Tod in die Nacht seinen todbringenden Ruf.
„Dies ist meine stille dunkle Unermesslichkeit,
Dies ist die Heimat immerwährender Nacht,
Dies ist die Heimlichkeit des Nichts,
Das die Eitelkeit der Lebenswünsche begräbt.
Hast du deinen Ursprung gesehen, O vergänglich Herz,
Und erkannt, woraus der Traum, der du bist, entstand?
In dieser blanken Wahrhaftigkeit einer nackten Leere
Hoffst du immerfort zu dauern und zu lieben?“
Die Frau gab keine Antwort. Ihr Geist wies ab
Die Stimme von Nacht, die wusste, und Tod, der dachte.
In ihrer anfangslosen Unendlichkeit
Blickte sie durch die unbegrenzten Bereiche ihrer Seele;
Sie sah die unvergänglichen Quellen ihres Lebens,
Sie wusste sich selbst als ewig ohne Geburt.
Doch noch immer widersetzte sich ihr mit endloser Nacht
Tod, der schreckliche Gott, auferlegend ihren Augen
Die unsterbliche Ruhe seines ungeheuren Blickes:
„Zwar hast du überlebt das ungeborene Leer,
Das nie verzeihen wird, solange Zeit währt,
Die ursprüngliche Gewalttat, die Denken formte,
Zwingend das bewegungslos Weite zu leiden und zu leben,
So hast du doch nur diesen traurigen Sieg errungen
Für eine Weile zu leben ohne Satyavan.
Was soll dir die uralte Göttin geben,
Die deinen Herzschlägen beisteht? Sie verlängert nur
Das Nichts geträumten Daseins und verzögert
Mit des Lebens Mühsal deinen ewigen Schlaf.
Ein zerbrechliches Wunderwerk aus denkendem Lehm,
Wandelt gewappnet mit Illusionen das Kind der Zeit.
Um die Leere zu füllen, die rings er fühlt und fürchtet,
Die Leere, woher er kam und wohin er geht,
Verherrlicht der Mensch sein Selbst und nennt es Gott.
Er ruft die Himmel zum Beistand seiner leidenden Hoffnungen.
Er sieht über sich mit sehnsüchtigem Herzen
Kahle Räume, noch unbewusster als er selbst,
Die nicht einmal sein Privileg des mentalen Geistes teilen,
Bar von allem außer ihrem unwirklichen Blau,
Und bevölkert sie mit lichten und barmherzigen Mächten.
Denn um ihn brüllt das Meer und die Erde wankt
Unter seinem Schritt, und Feuer ist an seinen Türen,
Und der Tod pirscht bellend durch die Wälder des Lebens.
Bewegt von den Gegenwarten, nach denen er sich sehnt,
Bringt er in unerbittlichen Schreinen seine Seele dar
Und kleidet alles mit der Schönheit seiner Träume.
Die Götter, die mit schlaflosen Augen über die Erde wachen
Und ihr Gigantentaumeln durch die Leere lenken,
Luden dem Menschen die Last seines Denkens auf;
In seinem unwilligen Herzen haben sie ihre Feuer entfacht
Und säten unheilbare Unrast darin.
Sein mentaler Geist ist ein Jäger auf unbekannten Fährten;
Ergötzend die Zeit mit nutzloser Entdeckerei,
Ergründet er mit Denken das Mysterium seines Schicksals
Und macht sein Lachen und Weinen zum Gesang.
Seine Sterblichkeit quälend mit den Träumen des Unsterblichen,
Betrübend seine Vergänglichkeit mit dem Hauch des Unendlichen,
Gaben sie ihm Hunger, den keine Nahrung stillen kann;
Er ist das Weidevieh der Hirtengötter.
Sein Körper der Strick, mit dem er angebunden ist,
Werfen sie Kummer und Hoffnung und Freude ihm als Futter vor:
Seinen Weideplatz haben sie mit Unwissenheit umzäunt.
In seine zerbrechlich ungeschützte Brust
Haben sie einen Mut eingehaucht, den der Tod bald trifft,
Haben sie eine Weisheit gewährt, die von der Nacht verspottet wird,
Haben sie eine Reise abgesteckt, die kein Ziel vorsieht.
Ziellos müht sich der Mensch in einer unsicheren Welt,
Beschwichtigt von unbeständigen Pausen seines Schmerzes,
Gepeitscht wie ein Tier von unendlichem Begehren,
Gebunden an den Streitwagen der furchtbaren Götter.
Doch wenn du noch hoffen kannst und noch lieben willst,
Kehr zurück zu deines Körpers Hülle, deiner Verbindung zur Erde,
Und mit den kleinen Überresten deines Herzens versuche zu leben.
Hoffe nicht, Satyavan für dich wiederzugewinnen.
Doch da deine Stärke keine triviale Krone verdient,
Kann Gaben ich dir geben, die dein wundes Leben lindern.
Die Pakte, die vergängliche Wesen mit dem Schicksal schließen,
Und die Wegesrandsüße, die erdgebundene Herzen pflücken würden,
Mach frei zu deinen, sofern dein Wille zustimmt.
Wähle eines Lebens Hoffnungen für deinen trügerischen Preis.“
Als die unbarmherzige und gewaltige Stimme verstummte,
Erhoben sich in Savitri unaufhörlich,
Gleich mondbeschienenen Kämmen auf einer bebenden Flut,
Gedankenwogen, aus einem Schweigen geboren,
Über das Meer ihres stummen unergründlichen Herzens.
Endlich sprach sie; ihre Stimme ward von der Nacht gehört:
„Ich beuge mich nicht vor dir, O du riesige Maske des Todes,
Schwarze Lüge der Nacht für die eingeschüchterte Menschenseele,
Unwirkliches, unausweichliches Ende der Dinge,
Du grimmiger Streich, gespielt dem unsterblichen Geist.
Im Bewusstsein der Unsterblichkeit wandle ich.
Im Bewusstsein meiner Stärke als siegreicher Geist,
Nicht als ein Bittender, kam ich an deine Tore:
Unbehelligt habe ich den Griff der Nacht überlebt.
Mein erstes schwere Leid rührt nicht meinen festen mentalen Geist;
Meine ungeweinten Tränen sind zu Perlen der Kraft geworden:
Ich habe meinen unförmigen spröden Lehm
Zur Härte einer in Stein gehauenen Seele gewandelt.
Im Ringen der prachtvollen Götter jetzt
Wird mein Geist unnachgiebig und stark bleiben
Gegen die ungeheure Weigerung der Welt.
Ich bücke mich nicht mit der untertänigen Schar von Gemütern,
Die mit zufriedenen Händen eifrig raffen
Zwischen trampelnden Füßen und dem Schmutz
Die verächtlich kleinen Zugeständnisse an die Schwachen.
Mein ist die Arbeit der kämpfenden Götter:
Auferlegend den langsamen zögerlichen Jahren
Den flammenden Willen, der jenseits der Sterne herrscht,
Prägen sie das Gesetz des Mentals den Werken der Materie auf
Und gewinnen von nichtbewusster Erdkraft der Seele Wunsch.
Zuerst verlange ich was auch immer Satyavan,
Mein Gemahl, der da erwachte in des Waldes Zauber
Aus den einsamen Träumen seiner langen reinen Kindheit,
Sich wünschte und nicht für sein schönes Leben hatte.
Gib, wenn du musst, oder, wenn du kannst, lehn ab.“
Der Tod neigte sein Haupt in höhnisch kalter Zustimmung,
Der Erbauer dieser traumartigen Erde für den Menschen,
Der alles, was er gab, mit Nichtigkeit narrt.
Erhebend seine unheilvolle Stimme sprach er:
„Nachsichtig Träumen gegenüber, die mein Hauch zerbricht,
Gewähre ich seines blinden Vaters sehnend Herz
Königreich und Macht und Freunde und einstige Größe
Und königlichen Prunk für sein friedvolles Alter,
Die fahlen Pomps des Menschen schwindenden Tage,
Die versilberten und verfallenden Glorien der Neige des Lebens.
Einem, der weiser ward durch widriges Geschick,
Erstatte ich Güter, die seine betörte Seele vorzieht
Der nackten Erhabenheit des unpersönlichen Nichts.
Den sinnlichen Trost des Lichtes gebe ich
Den Augen, die ein größeres Reich hätten finden können,
Eine tiefere Schau in ihrer abgrundtiefen Nacht.
Denn das hat dieser Mann vergeblich begehrt und erbeten
Als er noch auf Erden weilte und Hoffnung hegte.
Aus der Hoheit meiner gefahrvollen Gebiete geh,
Sterbliche, in deine kleine erlaubte Sphäre!
Eile raschen Fußes, dass nicht, dein Leben zu vernichten,
Die großen Gesetze aufstehen, die du verletzt hast,
Und schließlich ihre Marmoraugen auf dich öffnen.“
Doch Savitri antwortete dem verächtlichen Schatten:
„Weltgeist, ich ward als dir ebenbürtiger Geist geboren.
Auch mein Wille ist ein Gesetz, meine Stärke ein Gott.
Ich bin unsterblich in meiner Sterblichkeit.
Ich zittere nicht vor dem unbewegten Blick
Der unwandelbaren Marmorhierarchien,
Die mit den Steinaugen von Gesetz und Schicksal schauen.
Mit lebendigem Feuer kann meine Seele ihnen begegnen.
Gib mir aus deinem Schatten wieder zurück
In die blühenden Räume der Erde Satyavan
In der süßen Vergänglichkeit menschlicher Glieder,
Um mit ihm den brennenden Willen meines Geistes zu tun.
Ich will mit ihm die Last der uralten Mutter tragen,
Ich will mit ihm dem Pfad der Erde folgen, hin zu Gott.
Andernfalls sollen sich die ewigen Räume mir öffnen,
Während um uns fremde Horizonte fernhin weichen
Und wir zusammen das immense Unbekannte durchreisen.
Denn ich, die ich mit ihm die Gebiete der Zeit durchschritten habe,
Kann hinter seinen Schritten jedweder Nacht begegnen
Oder unvorstellbar gewaltiger Morgenröte,
Die da hereinbricht über unserem Geist im unbetretenen Jenseits.
Wohin du seine Seele auch führst, ich werde folgen.“
Doch ihrem Anspruch zuwider, unerbittlich,
Beharrend auf dem unwandelbaren Beschluss,
Beharrend auf dem erbarmungslosen Gesetz
Und der Bedeutungslosigkeit erschaffener Dinge,
Erscholl aus den wogenden Wüsten der Nacht,
Geboren aus dem Rätsel der unkennbaren Tiefen,
Eine Stimme voll Majestät und grässlichem Hohn.
Wie das sturmbehaarte titanschrittige Meer
Auf einen Schwimmer sein entsetzliches Gelächter wirft,
Erinnernd an all die Freude, die seine Wogen ertränkt haben,
So erhob aus der Finsternis der souveränen Nacht
Sich gegen das grenzenlose Herz der Frau
Der allmächtige Schrei des universalen Todes.
„Hast du Götterflügel oder Füße, die auf meinen Sternen schreiten,
Hast du, schwache Kreatur voll strebenden Mutes,
Deines Denkens Schranken, deine sterbliche Rolle vergessen?
Sie zogen ihre Kreise, bevor geformt war deine Seele.
Ich, Tod, erschuf sie aus meiner Leere;
Ich erbaute alles in ihnen und zerstör.
Ich machte mir die Welten zum Netz, jede Freude eine Masche.
Ein Hunger, verliebt in seine leidende Beute,
Leben, das verschlingt, in allem sieh mein Bild.
Sterbliche, deren Geist mein schweifender Atem ist,
Deren Flüchtigkeit durch mein Lächeln ersonnen ward,
Flieh und drück deine armseligen Gewinne an deine zitternde Brust,
Durchbohrt von meinen Schmerzen, die Zeit schwer stillt.
Blinde Sklavin meiner tauben Macht, die ich zwing
Zu sündigen, dass ich strafen kann, zu begehren,
Dass ich dich mit Verzweiflung und Kummer geißeln kann
Und du am Ende blutend zu mir kommst,
Deine Nichtigkeit begriffen, meine Größe erkannt,
Kehr um und trachte nicht nach verbotenen Glücksgefilden,
Bestimmt für Seelen, die mein Gesetz befolgen können,
Damit nicht an düsteren Schreinen wecke dein Schritt
Aus ihren unruhvollen eisenherzigen Schlaf
Die Furien, welche erfülltes Begehren rächen.
Fürchte, damit nicht in Himmeln wo Leidenschaft zu leben hoffte,
Blitze des Unbekannten aufflammen und du, in Panik,
Einsam, schluchzend, gejagt von den Hunden des Himmels,
Als wunde und verlassene Seele fliehst
Durch die lange Tortur der Jahrhunderte,
Und viele Leben nicht erschöpfen den unermüdlichen Zorn,
Den Hölle weder stillen noch Himmels Erbarmen besänftigen kann.
Ich will von dir lösen den schwarzen ewigen Griff:
Halte in deinem Herzen deines Schicksals dürftige Almosen fest
Und gehe in Frieden, wenn Friede für den Menschen rechtens ist.“
Doch Hohn mit Hohn begegnend antwortete Savitri,
Die sterbliche Frau zum furchtbaren Herrn:
„Wer ist dieser Gott, ersonnen von deiner Nacht,
Der mit Verachtung verschmähte Welten erschafft,
Der all die funkelnden Sterne schuf für nichts?
Nicht er, der in meinen Gedanken seinen Tempel errichtete
Und mein menschlich Herz zu seinem heiligen Boden machte.
Mein Gott ist Wille und triumphiert auf seinen Wegen,
Mein Gott ist Liebe und erträgt liebevoll alles.
Ihm habe ich Hoffnung als Opfer dargebracht
Und meine Sehnsüchte als ein Sakrament gegeben.
Wer könnte verhindern oder hemmen seinen Lauf,
Den Wundervollen, den Wagenlenker, den Schnellen?
Ein Reisender auf den Millionen Straßen des Lebens,
So geht sein Schritt, vertraut mit den Lichtern des Himmels,
Schmerzfrei durch die schwertgepflasterten Höfe der Hölle;
Dort steigt er hinab, um ewige Freude zu schärfen.
Der Liebe Goldflügel haben Macht, deine Leere zu fächeln:
Die Augen der Liebe blicken sterngleich durch Todes Nacht,
Die Füße der Liebe betreten nackt härteste Welten.
Er müht sich in den Tiefen, frohlockt auf den Höhen;
Er wird dein Weltall neu erschaffen, O Tod. “
Sie sprach und für eine Weile gab keine Stimme Antwort,
Während sie noch schritten durch die pfadlose Nacht
Und noch dieser Schimmer wie ein blasses Auge
Die Finsternis störte mit seinem zweifelnden Blick.
Dann trat wieder eine tiefe und gefährliche Pause ein
Auf der unwirklichen Reise durch blindes Nichts;
Noch einmal erhob sich ein Gedanke, ein Wort in der Leere
Und Tod gab Antwort der Menschenseele:
„Was erhoffst du dir? Was strebst du an?
Dies ist deines Körpers süßeste Verlockung der Seligkeit,
Bestürmt vom Schmerz, eine schwache unsichere Form,
Deinen schwankenden Sinn für ein paar Jahre zu erfreuen
Mit Honig leiblicher Sehnsüchte und dem Feuer des Herzens
Und, ein eitles Einssein suchend, zu umarmen
Das strahlende Idol einer flüchtigen Stunde.
Und du, was bist du, Seele, du glorreicher Traum
Aus flüchtigen Emotionen und glitzernden Gedanken,
Ein dürftiger Tanz von Glühwürmchen, schwirrend durch die Nacht,
Ein funkelnder Gärstoff im des Lebens sonnigem Schlamm?
Willst du Unsterblichkeit beanspruchen, O Herz,
Und gegen die ewigen Zeugen laut verkünden
Du und er seien endlos währende Mächte?
Tod allein währt und die nichtbewusste Leere.
Ich allein bin ewig und beständig.
Ich bin die formlos ungeheure Weite,
Ich bin die Leerheit, von Menschen Raum genannt,
Ich bin ein zeitloses Nichts, das alles trägt,
Ich bin der Unbegrenzbare, der stumm Alleinige.
Ich, Tod, bin Er; es gibt keinen anderen Gott.
Alles wird aus meinen Tiefen geboren, lebt durch Tod;
Alles kehrt zu meinen Tiefen zurück und ist nicht mehr.
Ich habe eine Welt durch meine nichtbewusste Kraft gemacht.
Meine Kraft ist Natur, die schafft und tötet
Die Herzen, die hoffen, die Glieder, die leben wollen.
Ich machte den Menschen zu ihrem Werkzeug und Knecht,
Seinen Körper zum Festmahl mir, sein Leben mir zum Schmaus.
Der Mensch hat keine andere Hilfe als allein den Tod;
Er kommt am Ende zu mir der Ruhe und des Friedens wegen.
Ich, Tod, bin für deine Seele die einzige Zuflucht.
Die Götter, die der Mensch anfleht, können dem Menschen nicht helfen;
Sie sind meine Einbildungen und meine Launen,
Die sich in ihm spiegeln durch die Macht der Illusion.
Was du als dein unsterbliches Selbst ansiehst
Ist eine schemenhafte Ikone meiner Unendlichkeit,
Ist Tod in dir, der von Ewigkeit träumt.
Ich bin das Unbewegte, in dem alle Dinge sich bewegen,
Ich bin die nackte Nichtigkeit, in der sie erlöschen:
Ich habe keinen Körper und keine Zunge zum Sprechen,
Ich verkehr nicht mit menschlichem Auge und Ohr;
Nur dein Denken gab meiner Leere eine Gestalt.
Weil du, O Strebende nach Göttlichkeit,
Mich riefst mit deiner Seele zu ringen,
Habe ich ein Antlitz, eine Form, eine Stimme angenommen.
Wenn aber Jemand Zeuge von allem wäre,
Wie sollte er deinem leidenschaftlichen Begehren helfen?
Unbeteiligt wacht er allein und absolut,
Gleichgültig gegenüber deinem Ruf in namenloser Ruh.
Sein Wesen ist rein, unversehrt, reglos, eins.
Eins blickt endlos auf das nichtbewusste Geschehen,
Wo alle Dinge vergehen, wie Schaum die Sterne.
Das Eine lebt für immer. Kein Satyavan
War dort geboren sich wandelnd, und keine Savitri
Verlangt dort von kurzem Leben ihr Bestechungsgeld der Freude.
Nie war Liebe dort mit weinerlichen Augen,
Weder Zeit noch die eitlen Weiten des Raumes gibt es dort.
Es trägt kein lebendiges Antlitz, es hat keinen Namen,
Keinen Blick, kein Herz, das schlägt; es fordert kein Zweites
Seinem Wesen zu helfen oder seine Freuden zu teilen.
Es ist Wonne, unsterblich für sich allein.
Wenn du Unsterblichkeit begehrst,
So sei allein du deiner Seele genug:
Lebe in dir selbst; vergiss den Mann, den du liebst.
Mein letzter großer Tod wird dich vom Leben befreien;
Dann steigst du auf in deinen ruhigen Quell.“
Doch Savitri gab Antwort der schrecklichen Stimme:
„O Tod, der du überzeugend argumentierst, ich argumentiere nicht,
Vernunft wägt ab und verwirft, kann aber nicht erbauen
Oder erbaut erfolglos, weil sie an ihrem Werke zweifelt.
Ich bin, ich liebe, ich sehe, ich wirke, ich will.“
Darauf der Tod, ein einziger tiefer umringender Schrei:
„Wisse auch. Wissend hörst du auf zu lieben,
Hörst auf zu wollen, von deinem Herz befreit.
Du wirst auf ewig ruhen und stille sein,
Einwilligend in die Unbeständigkeit der Dinge.“
Aber Savitri antwortete für den Menschen dem Tod:
„Habe ich für immer geliebt, werde ich wissen.
Liebe in mir kennt die Wahrheit im Wandelbaren.
Ich weiß, dass Wissen eine weite Umarmung ist:
Ich weiß, dass jedes Wesen ich selber bin,
In jedem Herzen verbirgt sich der zahllos Eine.
Ich weiß, der stille Transzendente trägt die Welt,
Der verhüllte Einwohner, der schweigende Herr:
Ich fühle sein heimliches Wirken, sein inniges Feuer;
Ich höre das Murmeln der kosmischen Stimme.
Ich weiß, mein Kommen war eine Woge von Gott.
Denn all seine Sonnen waren wach in meiner Geburtsstunde,
Und verhüllt vom Tod kam einer, der in uns liebt.
Dann ward der Mensch geboren unter den monströsen Sternen,
Mit einem Mental und Herz als Mitgift, um dich zu bezwingen.“
In der Ewigkeit seines unbarmherzigen Willens
Seines Reiches sicher, seiner bewehrten Macht,
Wie jemand, der heftige hilflose Worte verschmäht
Von Opfers Lippen, entgegnete Tod nicht mehr.
Er stand in Schweigen und in Dunkel gehüllt,
Eine unbewegliche Gestalt, ein unbestimmter Schatten,
Umgürtet mit den Schrecken seines geheimen Schwertes.
Halb sichtbar im Gewölk erschien ein düsteres Gesicht;
Der Nacht dämmrige Tiara war sein verfilztes Haar,
Die Asche vom Scheiterhaufen das Zeichen seiner Stirn.
Noch einmal Wanderin in der endlosen Nacht,
Von toten leeren Augen blindlings geächtet,
Zog sie durch die stummen hoffnungslosen Weiten.
Um sie herum wälzte sich die schauernde Wüste der Schwermut,
Wo verschlingende Leere und freudloser Tod
Ihrem Denken und Leben und Lieben widerstrebten.
Von ihr gedrängt durch die lange hinschwindende Nacht,
Halb sichtbar gleitend auf ihrem unirdischen Pfad,
Zogen gespensterhaft im Dunkel die drei dahin.
Ende des zweiten Cantos
Ende des neunten Buches